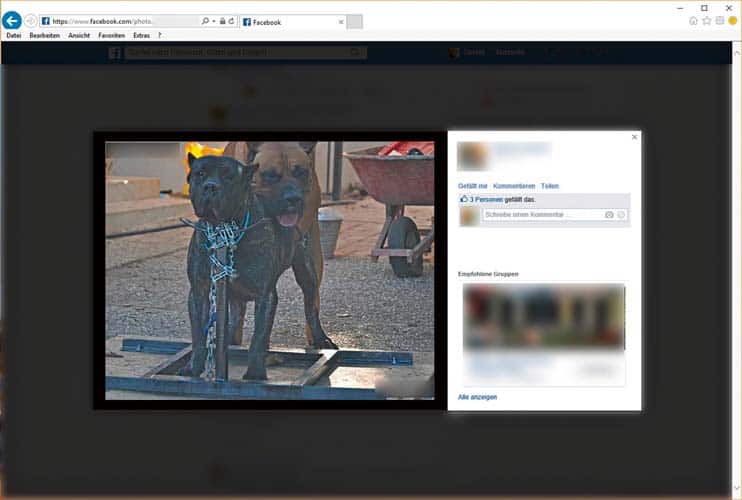Anders als beim Menschen ist es in der Hundezucht aber nicht die Hündin, die die Auswahl unter den Rüden treffen kann. Es ist der Mensch, der bestimmt, welcher Rüde welche Hündin decken muss. Und es ist oft ein „Muss", denn Züchter nehmen wenig Rücksicht darauf, ob die beiden, die verpaart werden sollen, das auch wirklich wollen. Zur Not wird nachgeholfen – der Möglichkeiten gibt es viele. Nach welchen Kriterien Rüden für eine Hündin ausgesucht werden sollten und warum es gar keine so schlechte Idee wäre, der Hündin ein Mitspracherecht einzuräumen, darüber berichtet Prof. Dr. Irene Sommerfeld-Stur in diesem Artikel.
Ein paar Sekunden nicht aufgepasst – und schon war es geschehen. Der hübsche Mischlingsrüde Wolle hatte sich über meine Wolfspitzhündin Tara hergemacht und sie zielstrebig und ohne zu zögern gedeckt. Bevor ich reagieren konnte, hingen die beiden Hunde untrennbar aneinander und mir blieb nichts anderes übrig als zu warten, bis die Sache vorbei war und die Hunde sich wieder voneinander lösten. 9 Wochen später kam dann das Produkt des „Unfalls" zur Welt. Sieben putzmuntere Welpen. Einer dieser Hunde, Mimi, hat dann noch 14 Jahre lang mein Leben geteilt.
Tara und Wolle, das war, wenn man es etwas vermenschlicht betrachtet, eine große Liebe. Die beiden Hunde trafen sich fast täglich im Reitstall, in dem damals mein Pferd untergebracht war, und waren in dieser Zeit untrennbar. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Tara von Wolle gedeckt wurde, war sie am Ende ihrer Läufigkeit und hatte bereits zwei anderen Rüden nachdrücklich zu verstehen gegeben, dass sie eine nähere Beziehung nicht mehr wünschte. Für Wolle machte sie eine Ausnahme.
Diese Form der Paarung – von beiden Partnern akzeptiert oder sogar angestrebt – war über viele Jahrtausende die wesentliche Grundlage der Fortpflanzung von Hunden. Und wahrscheinlich ist es sogar dieser Form der Partnerwahl zu verdanken, dass es heute überhaupt Hunde gibt.
In der heutigen Rassehundezucht sieht die Sache anders aus. Da sind es die Menschen, die bestimmen, wer sich mit wem verpaaren darf. Die Hunde haben kaum ein Mitspracherecht. Denn selbst wenn die beteiligten Hunde sich verweigern, finden Züchter Möglichkeiten, den Deckakt zu erzwingen oder durch eine instrumentelle Samenübertragung überflüssig zu machen. Bei der Auswahl der Zuchttiere spielen verschiedenste Überlegungen eine Rolle – die Sympathie zwischen den beiden Hunden wird nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.
Natürlich wäre es nicht im Sinne einer gezielten Rassehundezucht, wenn man den Hunden völlig freie Bahn ließe. Aber ein wenig Mitspracherecht wäre kein Fehler. Davon später.
Zunächst mal – was sind es denn für Überlegungen, die bei der Auswahl eines Rüden für eine Hündin oder umgekehrt angestellt werden bzw. werden sollten?
Äußerliche Merkmale
Der Formwert eines Hundes – bewertet im Rahmen von Ausstellungen – spielt sowohl bei der Entscheidung für oder gegen einen Zuchteinsatz als auch bei der Wahl des Paarungspartners eine wichtige Rolle. Kein Hund ist fehlerlos, und so sollten bei der Auswahl des Partners die Fehler und Vorzüge der Hündin sowie des Rüden genau erfasst werden. Im Idealfall kompensiert der Rüde durch seine Vorzüge die Fehler der Hündin und umgekehrt. Ähnliches gilt für Verhaltensmerkmale, auch wenn bei diesen die Umwelt eine viel größere Rolle spielt als der Genotyp.
Was leider oft gemacht wird, dass ein vorzüglicher Rüde, mehrfacher Ausstellungssieger und Champion, von vielen Hündinnenbesitzern als Paarungspartner für ihre Hündin gewählt wird. Das führt dann zu dem verhängnisvollen „Popular-Sire"-Effekt. Nicht nur, dass es zu einem überdurchschnittlichen Anstieg des Inzuchtniveaus in der Population kommt, trägt der „Vielgeliebte" ein oder mehrere rezessive Schadgene, werden diese weit in der Population verbreitet. Ein paar Generationen später wundern sich dann die Züchter, wieso auf einmal so viele Hunde mit einer genetisch bedingten Erkrankung auftreten.
Abhilfe können Zuchtverbände schaffen, indem sie den Deckeinsatz für Rüden limitieren. Abhilfe kann aber auch jeder einzelne Hündinnenbesitzer treffen, indem er bei der Auswahl eines Deckrüden auch die Zahl der bereits vorhandenen Nachkommen berücksichtigt. Zu bedenken ist dabei auch, dass nicht nur die vielprämierten Champions vorzügliche und dem Rassestandard entsprechende körperliche Merkmale tragen. Denn jeder mit sehr gut oder vorzüglich bewertete Rüde entspricht dem Rassestandard und sollte daher als möglicher Paarungspartner ins Auge gefasst werden.
Genetische Belastungen
Besonderes Augenmerk sollte bei der Auswahl auf mögliche genetische Belastungen des Paarungspartners gelegt werden. Das umfasst sowohl Erkrankungen der Kandidaten selbst als auch Erkrankungen in ihrem genetischen Umfeld. Besonders dann, wenn z.B. in der Verwandtschaft der Hündin Erkrankungen bekannt sind, dann sollte in der Verwandtschaft der in Frage kommenden Rüden genau nach vergleichbaren Erkrankungen gefragt werden. Leider ist gerade dieser Punkt in der Praxis sehr schwer umzusetzen, denn über Erkrankungen wird in Züchterkreisen nicht gerne geredet. Eine offene Kommunikation über Krankheiten in der eigenen Linie ist die Ausnahme und wird zudem von den Züchterkollegen gar nicht gerne gesehen. Als Nestbeschmutzer, die eine Rasse krankreden, werden ehrliche Züchter bezeichnet und im schlimmsten Fall aus der Züchtercommunity ausgeschlossen. Genetische Belastungen eines möglichen Paarungspartners zu eruieren gleicht somit manchmal einer richtigen Detektivarbeit.
Der Zuchtwert
Genetische Belastungen sind Zuchttieren in den meisten Fällen nicht anzusehen. Jeder gesunde Hund kann ein oder mehrere Defektgene tragen, die er bei einem Zuchteinsatz an seine Nachkommen weitergibt. Die Abklärung möglicher genetischer Belastungen ist somit ein wichtiger Punkt im Rahmen der Zucht gesunder Hunde.
Ein Verfahren, das primär aus der Nutztierzucht stammt, kann auch beim Hund wertvolle Hilfestellung leisten. Die Zuchtwertschätzung nach dem Tiermodell ist ein statistisches Verfahren, das Informationen von möglichst vielen Verwandten eines Zuchttieres – des Probanden – auswertet und daraus für einzelne Merkmale einen Zuchtwert ermittelt. Dieser gibt eine Information darüber, wie weit der Proband in Bezug auf die genetische Konstellation für das betreffende Merkmal vom Populationsdurchschnitt abweicht. Zuchtwerte können sowohl für Formwert- und Leistungsmerkmale als auch für Erkrankungen ermittelt werden. Damit können Zuchtwerte sowohl für die Selektion als auch für die Auswahl von Paarungspartnern eingesetzt werden. Entscheidend für die Partnerwahl ist der zu erwartende Zuchtwert der Nachkommen, der sich aus dem durchschnittlichen Zuchtwert der beiden prospektiven Elterntiere ergibt. Der Vorteil bei dieser Methode liegt darin, dass auch Zuchttiere mit einem schlechteren Zuchtwert für ein Merkmal eingesetzt werden können, wenn der Paarungspartner für dieses Merkmal einen besonders guten Zuchtwert hat. Der Vorteil für die Zuchtpopulation ergibt sich daraus, dass mehr Tiere an der Produktion der Nachkommengeneration beteiligt sind und damit der Verlust an genetischer Vielfalt geringer ausfällt. Auch die Zuchtwertschätzung ist aber darauf angewiesen, dass ausreichend viele und richtige Informationen der verwandten Hunde zur Verfügung stehen.
Genetische Vielfalt
Ständiger Verlust an genetischer Vielfalt ist ein Charakteristikum der kleinen geschlossenen Zuchtpopulationen, die in der Hundezucht fast durchwegs zu finden sind. Mit jeder Generation gehen der Population Gene verloren. Die Folgen sind zunehmende Inzuchtdepressionserscheinungen wie erhöhte Krankheitsanfälligkeit, verringerte Fruchtbarkeit und herabgesetzte Lebenserwartung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine zunehmende Häufung von genetischen Defekten. Insbesondere die Zunahme der Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen ist möglicherweise eine Folge des zunehmenden Inzuchtanstiegs und des damit verbundenen Verlustes an genetischer Vielfalt. Viele Rassehundepopulationen sind mit diesen Konsequenzen des laufenden Verlustes an genetischer Vielfalt in zunehmendem Maß konfrontiert. Die Erkenntnis der Problematik lässt Zuchtverbände auch zunehmend zu Maßnahmen greifen, um diesen Verlust an genetischer Varianz zu limitieren.
Der Inzuchtkoeffizient (IK)
Das klassische Verfahren zur Kontrolle des Inzuchtanstiegs ist die Berechnung des Inzuchtkoeffizienten (IK) der möglichen Nachkommen einer bestimmten Anpaarung aus dem Pedigree der beteiligten Elterntiere. Der IK ist ein Maß für die Verwandtschaft zwischen den Eltern eines Hundes und damit auch ein Maß für den wahrscheinlichen Anteil homozygoter Genorte dieses Hundes.
Grundlage der Berechnung des IK der Nachkommen sind Ahnen, die sowohl im Pedigree des Vaters als auch im Pedigree der Mutter auftreten. Musste man diese Berechnungen früher mühsam händisch durchführen, stehen dafür heute Computerprogramme zur Verfügung. Das hat einerseits den Vorteil einer weniger mühsamen und auch weniger fehleranfälligen Art der Berechnung. Auf der anderen Seite ergeben sich aus dieser mechanisierten Methode auch ein paar Überlegungen, die bei der Interpretation der berechneten Werte berücksichtigt werden sollten. So ist ein wichtiger Punkt, dass der Wert des IK von der Zahl der Generationen, die bei der Berechnung berücksichtigt werden, abhängt. Werden z.B. nur vier Ahnengenerationen in die Berechnung miteinbezogen, ergibt sich bei ein und demselben Hund ein niedrigerer Wert für den IK als bei Berücksichtigung von z.B. acht Generationen. Im Gegensatz zur händischen Berechnung, bei der der IK im Allgemeinen aus maximal fünf Generationen berechnet wurde, kann die Berechnung über Software bis zu den Gründertieren zurückgehen. Bei der Nutzung des IK zur Auswahl eines Deckrüden sollte daher auch immer gesichert werden, dass der IK der Nachkommen der möglichen Paarungskombinationen mit der gleichen Methode berechnet wurde. Denn nur dann ist ein Vergleich möglich.
Der IK hat zudem einen wesentlichen praktischen Nachteil. Er ist ein reiner Wahrscheinlichkeitswert, der sich aus den angegebenen Vorfahren im Pedigree eines Hundes ergibt. Betrachtet man Welpen eines Wurfes, haben diese alle den gleichen IK. Der tatsächliche Anteil homozygoter Genorte kann aber innerhalb der Nachkommen eines Wurfes recht unterschiedlich sein.
Der Ahnenverlustkoeffizient (AVK)
Der AVK lässt sich ebenfalls aus dem Pedigree eines Hundes ermitteln. Er ist definiert als der Anteil tatsächlich unterschiedlicher Ahnen an der Gesamtzahl möglicher Ahnen eines Hundes. Bei Berücksichtigung von z.B. fünf Ahnengenerationen kann ein Hund maximal 62 verschiedene Vorfahren haben. Kommt nun z.B. ein Ahne in der fünften Ahnengeneration zweimal vor, dann reduziert sich die Zahl der möglichen Vorfahren auf 61, der AVK würde sich in diesem Fall mit 61/62=0,98 berechnen. Je mehr Ahnen im Pedigree eines Hundes mehrfach auftreten, umso niedriger wird der AVK. Er ist daher genau wie der IK geeignet, bei der Wahl des Paarungspartners ein möglichst geringes Inzuchtniveau bei den Nachkommen zu gewährleisten.
IK und AVK geben ähnliche Aussagen, allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied. Paart man zwei Hunde miteinander, die selbst jeweils einen sehr hohen Inzuchtkoeffizienten haben, die aber keinen gemeinsamen Ahnen haben, ergibt sich rein rechnerisch für die Nachkommen ein IK von Null. Bei der Berechnung des AVK wirkt sich aber die Tatsache aus, dass die hoch ingezüchteten Eltern in ihrem jeweiligen Pedigree viele gleiche Ahnen haben. Die Berechnung des AVK gibt somit eine realistischere Information über das Ausmaß an genetischer Vielfalt, das den Nachkommen einer bestimmten Paarung zur Verfügung steht.
Ganz gleich wie der IK hat aber auch der AVK den Nachteil, dass er ein theoretischer Erwartungswert ist, der auf den Angaben im Pedigree eines Hundes beruht. Abgesehen davon, dass Angaben im Pedigree auch mal falsch sein können, kann das tatsächliche Ausmaß an Homozygotie eines individuellen Hundes von den berechneten Erwartungswerten mehr oder weniger stark abweichen. Um bei der Zuchtplanung für die Nachkommen tatsächlich die besten Voraussetzungen zu schaffen, ist daher eine Berücksichtigung des individuellen Genotyps die bessere Lösung. Molekulargenetische Methoden, die den Genotyp eines Hundes in vielen Bereichen exakt ermitteln können, sind somit ein wertvolles Hilfsmittel nicht nur bei der Selektion gegen Defektgene, sondern auch bei der Zusammenstellung optimaler Paarungen.
SNP-Haplotypen
SNPs – diese drei Buchstaben stehen für „Single Nucleotid Polymorphism" und sind die modernsten Werkzeuge der Molekulargenetik. Kombinationen von SNPs werden als SNP-Haplotypen bezeichnet. SNPs ermöglichen eine sehr umfangreiche Analyse des Erbguts und sind zurzeit die Grundlage zahlreicher Assoziationsstudien, in denen die genetische Grundlage der Variation von Merkmalen sowie von Erkrankungen ermittelt werden soll. Ein sehr interessanter Einsatzbereich für SNPs ist auch ihre Analyse im Rahmen der Partnerwahl. Denn SNPs geben im Gegensatz zum IK oder AVK auch eine Information über das ganz individuelle Ausmaß der genetischen Vielfalt eines Hundes. Auf der Basis von mehr als 10.000 SNPs lässt sich die genetische Vielfalt sowohl auf individueller Ebene als auch auf Populationsebene weitaus sicherer erfassen als auf der Basis von Pedigreedaten, wie in einer aktuellen Studie auf der Basis von Computersimulationen festgestellt wurde (Kardos et al., 2015). Da die SNP-Diagnostik auch eine relativ preisgünstige Methodik darstellt, wäre ein Einsatz in der praktischen Hundezucht im Rahmen der Auswahl von Paarungspartnern eine sinnvolle Möglichkeit zum Erhalt der genetischen Vielfalt.
Immunabwehr durch DLA-Haplotypen
Eine funktionierende Immunabwehr ist eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes und langes Hundeleben. Für die Immunabwehr ist eine Gengruppe verantwortlich, die unter der Bezeichnung MHC (Major Histocompatibility Complex) zusammengefasst wird. Ein Teil dieser Gengruppe ist beim Hund der DLA (Dog Leukozyte Antigen)-Komplex, der zudem bereits recht genau untersucht ist. Innerhalb der gesamten Spezies Hund zeigen Gene aus diesem Bereich eine enorme Vielfalt. Die ist auch notwendig, um eine erfolgreiche Auseinandersetzung des Immunsystems mit den zahlreichen und unterschiedlichen Angriffen aus der Umwelt zu ermöglichen. Innerhalb einzelner Rassen ist die Vielfalt im DLA-Bereich aber zum Teil auf erschreckende Art reduziert. So sind, um nur ein Beispiel zu nennen, bei einem Gen, von dem über die gesamte Spezies Hund insgesamt 50 verschiedene Genvarianten bekannt sind, beim Boxer und beim Golden Retriever nur mehr 10 Genvarianten zu finden (Ross et al., 2012). In verschiedenen Rassen wurden zudem Assoziationen zwischen bestimmten Genvarianten aus dem Bereich der DLA-Gene einerseits sowie dem Anteil homozygoter DLA-Gene andererseits und Autoimmunkrankheiten gefunden (Kennedy et al., 2012).
Autoimmunkrankheiten beruhen auf einer Fehlfunktion des Immunsystems, bei dem körpereigenes Gewebe angegriffen und zerstört wird. Die zu beobachtende Zunahme an Autoimmunerkrankungen in diversen Hunderassen ist somit mit großer Wahrscheinlichkeit u.a. mit dem ebenfalls beobachteten Verlust an genetischer Vielfalt in diesem Bereich zu erklären. Es liegt somit auf der Hand, bei der Auswahl von Paarungspartnern auch den Genotyp im Bereich der DLA-Gene zu berücksichtigen. Dabei sollte einerseits auf bekannte Risikoallele geachtet werden, als auch auf insgesamt möglichst große Unterschiede in den DLA-Genen zwischen Rüden und Hündin.
Und hier schließt sich der Kreis – diese Auswahl könnte man getrost den Hunden selbst überlassen. Von verschiedenen Tierarten, u.a. von Spatzen ist bekannt, dass die Weibchen bei der Auswahl ihrer Partner diese nach größtmöglichen Unterschieden im Bereich des MHC treffen (Griggio et al., 2011). Damit garantieren sie für ihre Jungen größtmögliche Vielfalt in diesem für eine funktionierende Immunabwehr so wichtigen Gensystem.
Es wäre somit auch in der Hundezucht durchaus sinnvoll, den Hündinnen zumindest ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Rüden einzuräumen. Denn Paarungen, bei denen sich Hündin und Rüde gar nicht mögen, resultieren möglicherweise in Welpen mit geringer Varianz im DLA-Bereich, deren Immunsystem für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit den vielfältigen Angriffen aus der Umwelt nur unzureichend gerüstet ist. Oder gar in verhängnisvollen Kombinationen von Risikogenen für immunologische Erkrankungen. Alternativ könnte eine Bestimmung der DLA-Gene bei der Hündin und den in Frage kommenden Rüden mithelfen, ausreichende Vielfalt im DLA-Bereich für die nachkommenden Generationen zu gewährleisten.
Und wer weiß – vielleicht waren es Unterschiede in genau diesem Gensystem, die den Rüden Wolle für meine Tara so anziehend gemacht haben.
Hintergrund
Gentests
Für viele der in den Rassepopulationen auftretenden genetischen Defekte, aber auch für diverse Merkmale aus dem Bereich der Fellfarben und der Fellstruktur stehen heute molekulargenetische Diagnoseverfahren, sogenannte Gentests, zur Verfügung.
Im Idealfall kann durch den Gentest für ein monogenes dominant/rezessives Merkmal mit hundertprozentiger Penetranz der individuelle Genotyp eines Hundes ermittelt werden. Das heißt, dass man aus dem Testergebnis sowohl das individuelle Erkrankungsrisiko eines Hundes als auch das Risiko der Weitergabe eines Defektgens an die Nachkommen ablesen kann.
Bei Erkrankungen, bei denen heterozygote Anlageträger der Erkrankung genauso gesund sind wie homozygot freie Hunde und nur bei den homozygoten Merkmalsträgern die Erkrankung auch tatsächlich auftritt, kann man Anlageträger, in bestimmten Fällen sogar Merkmalsträger in der Zucht einsetzen, wenn man sie an homozygot freie Hunde anpaart. Das hat den Vorteil, dass Gene der belasteten Hunde der Population nicht verloren gehen und trotzdem gesichert ist, dass bei den Nachkommen die betreffende Krankheit nicht auftreten kann.
Nicht alle angebotenen Gentests erfüllen allerdings die genannten Voraussetzungen. Sei es, dass auch Hunde mit heterozygotem Genotyp erkranken können, sei es, dass nur ein Teil der Hunde mit homozygot rezessivem Genotyp erkrankt. Bevor ein Gentest bei der Auswahl von Paarungspartnern eingesetzt wird, ist es daher notwendig, sich genau über die Aussagekraft des angebotenen Tests zu informieren.
WUFF-Information
Zitierte Literatur
• Kardos, M. et al (2015): Measuring individual inbreeding in the age of genomics: marker-based measures are better than pedigrees. Heredity 115, 63–72
• Ross, P. et al. (2012): Allelic diversity at the DLA-88 locus in Golden Retriever and Boxer breeds is limited. Tissue Antigens. 80(2): 175–183
• Griggio, M. et al. (2011): Female house sparrows "count on" male genes: experimental evidence for MHC-dependent mate preference in birds. BMC Evolutionary Biology 11:44
• Kennedy, L.J. et al. (2012): Canine Immunogenetics. In: Ostrander, E. and Rovinski, A.: Genetics of the dog, 2nd Edition, CABI