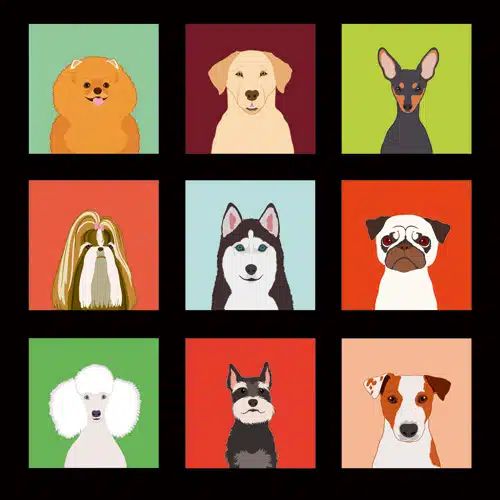Die Fellfarbe ist eines der Merkmale beim Hund, dem im Rahmen der Selektion sehr hohes Augenmerk geschenkt wird. Bei manchen Rassen mehr, bei anderen weniger, steht die Farbe im Mittelpunkt des züchterischen Interesses. Rassetypische Farben sind im Rassestandard festgelegt, Hunde, die in Bezug auf die Farbe unerwünschte Abweichungen zeigen, werden zur Zucht nicht zugelassen. Dass und inwiefern Gene, die für die Fellfarben unserer Vierbeiner verantwortlich sind, auch Einflüsse auf Gesundheit und Verhalten haben, erklärt Univ. Prof. Dr. Irene Sommerfeld-Stur im folgenden Artikel.
Lange Zeit war es sogar üblich, Welpen, die mit einer Fehlfarbe auf die Welt kommen, gleich nach der Geburt zu töten (Anm. d. Red.: s. WUFF 10/1996). Diese Vorgehensweise ist inzwischen durch das Tierschutzgesetz verboten. Wieweit im stillen züchterischen Kämmerlein Welpen mit erkennbaren Fehlfarben nach wie vor getötet werden, bleibt dahingestellt.
Auf der anderen Seite kommt es auch immer wieder vor, dass neue Farben in Rassen auftauchen, die dann bewusst weitergezüchtet werden, weil sie attraktiv erscheinen und entsprechende Nachfrage besteht. Gelegentlich kommt es sogar vor, dass ursprünglich als Fehlfarbe definierte Farbvarianten gewissermaßen rehabilitiert werden und die offizielle Farbpalette einer Rasse erweitern oder sogar zur Entstehung einer neuen Rasse führen. So galt beim Boxer die weiße Farbe lange Zeit als Fehlfarbe, weiße Welpen wurden getötet (Anm. d. Red.: s. WUFF 10/1996). Seit kurzem gibt es Intentionen, den weißen Boxer wieder „salonfähig“ im züchterischen Sinn zu machen.
Ein anderes Beispiel ist der West Highland White Terrier, der aus fehlfarbenen Varianten des Cairn Terriers entstand – dem Vernehmen nach, weil ein Cairn Terrier-Züchter einen seiner Hunde versehentlich bei der Jagd erschossen hatte, weil er ihn für einen Fuchs gehalten hatte. Die auffallend weiße Farbe sollte solche Versehen in Zukunft verhindern.
Manchmal können Farben auch falsche Abstammungsangaben entlarven, wenn z.B. aus zwei roten Hunden ein schwarzer Welpe fällt, oder wenn in einer farblich durchgezüchteten Rasse eine fremde Farbe auftaucht.
Die genetischen Grundlagen der Fellfärbung sind äußerst komplex, eine ganze Reihe verschiedener Genorte beeinflusst die individuelle Fellfarbe. Die molekulargenetische Forschung ermöglicht inzwischen für viele Farbgene die Feststellung des Genotyps und erleichtert dadurch gezielte Selektion auf bestimmte Farbvarianten.
Es stellt sich nun die Frage, wieweit der gehandhabte züchterische Umgang mit Farben sinnvoll ist. Dabei ist zu überlegen, ob Fellfarben als rein äußerliches optisches Merkmal anzusehen sind oder ob mehr hinter den Farben des Hundes steckt.
Schutz und Tarnung
Wenn man die Färbung von Tieren im evolutionären Kontext betrachtet, so hat sie in erster Linie Schutzfunktion. Dunkles Pigment schützt vor schädigenden UV-Strahlen und absorbiert Wärme. So findet man z.B. bei Rindern ein Gen, das für eine pigmentierte Augenumgebung sorgt und somit die Rinder vor dem Auftreten von Hautkrebs im Augenbereich schützt. Dies ist besonders wichtig bei Rindern in südlichen Regionen, die überwiegend helles Haarkleid haben. Dieses helle Haarkleid ist in warmen Regionen wiederum ein Selektionsvorteil, weil es einerseits weniger Wärme absorbiert und anderseits Insekten durch die helle Farbe weniger stark angezogen werden.
Auch bei nicht oder wenig pigmentierten Hunden ist die Disposition zu einer Solardermatitis bekannt, die als entzündliche Reaktion der ungeschützten Haut auf intensive Sonnenbestrahlung auftritt.
Die zweite Schutzfunktion betrifft die Tarnung. Tiere mit Farbtönen, die der jeweiligen Umgebung angepasst sind, fallen weniger auf. Das dient sowohl dem Beutetier, das weniger leicht erbeutet wird, als auch dem Predator, der von der Beute nicht frühzeitig gesehen wird.
Da in verschiedenen Weltregionen die Klimabedingungen und Farben der Umwelt unterschiedlich sind, ergab sich daraus im Rahmen der Evolution, aber auch im Laufe der Domestikation, eine mehr oder weniger große Varianz der Farben. So findet sich in nördlichen, schneereichen Regionen zum Teil die weiße Farbe, in trockenen, heißen Regionen mit wenig pflanzlichem Bewuchs überwiegen die rötlichen Farben, und in den gemäßigten Klimazonen, mit jahreszeitlich sich ändernden Bedingungen die Brauntöne, oft mit der typischen Agoutifärbung, die aus einer Kombination von Schwarz- und Rottönen im Fell besteht.
Dass Farbe auch eine Funktion im Rahmen der Temperaturregulation hat, zeigt die Tatsache, dass die Körperunterseite bei dunkel pigmentierten Tieren immer etwas heller ist als die Rückenpartie. Die geschütztere Bauchseite benötigt weniger Wärmeisolation als die exponierte Rückenpartie.
Beim Menschen ist bekannt, dass die Art des Melanins auch einen Einfluss auf die Schmerzempfindlichkeit hat. So sprechen rothaarige Frauen besser auf ein bestimmtes Schmerzmittel an als dunkelhaarige.
Wir sehen schon, dass Farbe bei Weitem nicht nur eine optische Bedeutung hat, sondern in verschiedenen anderen Bereichen Funktionen erfüllt.
Die Wirkung von Farben geht aber noch weiter. Dabei sind grundsätzlich zwei Mechanismen zu unterscheiden.
1) Farbgene beeinflussen neben der Pigmentierung auch noch andere Stoffwechselbereiche. Dieser Effekt wird als Pleiotropie bezeichnet.
2) Farbgene sind gekoppelt mit Genen, die andere Wirkungen haben. Sie liegen also in unmittelbarer Nähe dieser Gene und werden mit diesen gemeinsam vererbt.
Pleiotropie – Farbgene sind vielseitig
Die grundsätzliche Wirkung von Genen besteht darin, dass sie Aufbauanweisungen für Proteine liefern. Genkodierte Proteine erfüllen Aufgaben im Körper u.a. in der Form von Strukturproteinen, Enzymen, Hormonen oder Immunglobulinen. Dabei können bestimmte Genprodukte ihre Aufgabe in unterschiedlichen Bereichen des Organismus oder aber auch zu unterschiedlichen Zeiten des Lebens erfüllen. Ein einzelnes Gen kann daher mehrere Merkmale beeinflussen.
Um den Effekt der Pleiotropie von Farbgenen zu verstehen, müssen wir uns ein wenig mit den biochemischen Grundlagen der Pigmentierung beschäftigen.
Melanin und Melanozyten: Basis der Pigmentierung
Die chemische Grundlage der Pigmentierung ist Melanin. Melanin wird vom Körper selber in den sogenannten Melanozyten (Melanin produzierende Zellen) hergestellt. Für die Produktion des Melanins sind zwei Zutaten notwendig: der Grundbaustein des Melanins, das ist die Aminosäure Tyrosin, und ein Enzym, die Tyrosinase. Aus diesen zwei Zutaten wird über mehrere Zwischenprodukte das Melanin hergestellt.
(Mehr über die Bedeutung des Melanins und Zusammenhänge mit dem Verhalten siehe unten.)
Ein zweiter Punkt, der für die Pigmentierung notwendig ist, ist die Anwesenheit von Melanozyten. In den Melanozyten wird Melanin gebildet, zu einer Pigmentierung kann es also nur dort kommen, wo Melanozyten vorhanden sind. Melanozyten entstehen im Lauf der Embryonalentwicklung im Bereich der Neuralleiste, also des späteren Rückenmarks. Von dort verteilen sie sich in der weiteren Entwicklung im Normalfall gleichmäßig über die Körperoberfläche und wandern außerdem zu bestimmten Organen, an denen ihre Funktion benötigt wird. Diese Wanderung der Melanozyten kann nun durch genetische Fehler behindert werden, so dass sie sich entweder ungleichmäßig verteilen oder überhaupt nicht an die Stellen kommen, an denen sie benötigt werden. Von der Farbe her ergibt sich daraus entweder eine Scheckung oder im Extremfall komplett weiße Farbe.
Gesundheitliche Probleme ergeben sich dann, wenn z.B. auch im Innenohr keine Melanozyten eingewandert sind, denn dort erfüllen diese Zellen wichtige Funktionen für die Übertragung akustischer Reize. Das Fehlen von Melanozyten im Innenohr führt daher zu der bekannten sensorineuralen Taubheit, von der in mehr oder weniger großer Häufigkeit alle jene Rassen betroffen sind, deren Scheckung oder Weißfärbung auf der Hemmung der Melanozytenverteilung beruht. Das Problem dabei ist, dass nicht alle Tiere mit Scheckung oder Weißfärbung von dieser Form der Taubheit betroffen sind. Welche Mechanismen speziell dafür verantwortlich sind, ist bis heute noch nicht genau bekannt. Deshalb ist bei gefährdeten Rassen in jedem Fall zu empfehlen, bei Zuchttieren das Gehör durch eine Hirnstammaudiometrie überprüfen zu lassen und nur beidseitig hörende Tiere zur Zucht einzusetzen. Da dieses Untersuchungsverfahren bereits bei sieben Wochen alten Welpen eine verlässliche Aussage über das Hörvermögen gibt, haben auch Welpenkäufer die Möglichkeit, vor dem Kauf eines Welpen dessen Hörvermögen überprüfen zu lassen.
Merlefärbung – attraktive Farbvariante mit Defektpotenzial
Eine zweite Farbvariante, die das Hörvermögen, zusätzlich aber auch noch das Sehvermögen sowie den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen kann, ist die Merlefärbung. Das Wirkungsprinzip ist ein ähnliches wie bei dem Scheckungsweiß. Auch für die durch die Merlefärbung bedingten Störungen ist das Fehlen von Melanozyten verantwortlich. Hier verteilen sich die Melanozyten allerdings zunächst ungestört. Durch eine Mutation am sogenannten SILV-Locus kommt es aber zu einer nachträglichen Zerstörung dieser Zellen, bei homozygoten Tieren nicht nur im Bereich der Haut, sondern auch im Bereich des Innenohres und der Augen. Homozygote Merles haben daher einerseits eine ausgeprägte Weißfärbung des Fells, andererseits Schädigungen im Bereich der Ohren und der Augen, die bis zum vollständigen Fehlen der Augen gehen können.
Das Merle-Gen ist ein dominantes Gen, das aber nur im homozygoten Genotyp die beschriebenen Schäden auslöst. Im heterozygoten Genotyp ergibt sich eine Scheckung mit unregelmäßig grau aufgehellten schwarzen Flecken – die Merlefärbung. Es ist daher durchaus möglich, den attraktiven Phänotyp des sogenannten Merletigers zu züchten, wenn man die Paarungen so auswählt, dass keine homozygoten Merlegenotypen entstehen können. Ein Merletiger sollte daher immer nur mit einem normal gefärbten Partner verpaart werden. Ganz unproblematisch ist diese Vorgehensweise aber auch nicht. Denn einerseits findet sich nach einer Studie von STRAIN et al. (2009) auch unter den heterozygoten Merles ein gewisser Anteil an tauben Tieren (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19192156 ). Und andererseits sind nicht alle heterozygoten Merles als solche erkennbar. Um unbeabsichtigte Paarungen zweier heterozygoter Merles zu vermeiden, empfiehlt sich daher in betroffenen Rassen die Durchführung eines Gentests, der von einzelnen Laboren angeboten wird.
Harlekin-Doggen – doppelt schädlich
Spezielle Verhältnisse liegen bei Doggen vor. Bei dieser Rasse gibt es einerseits das Merle-Gen, das aber in Kombination mit einem anderen rassespezifischen Gen, dem Harlekin-Gen, auftritt. Dieses sorgt in der Kombination mit dem Merle-Gen für die sogenannten Grautiger. Diese Hunde sind sowohl am Merle-Genort als auch am Harlekin-Genort heterozygot und zeigen grau-schwarze Flecken auf weißer Grundfarbe. Tiere, die homozygot für das Merle-Gen sind, zeigen einen sehr großen Weißanteil und, so wie alle homozygoten Merles, Beeinträchtigungen im Bereich der Sinnesorgane. Tiere, die homozygot für das Harlekin-Gen sind, gibt es nicht, die sterben nämlich in der frühen Embryonalphase. In doppelter Dosis ist das Harlekin-Gen somit ein echter Letalfaktor. Das mag aus praktischer Sicht nicht besonders problematisch erscheinen – diese Hunde kommen eben einfach nicht zur Welt. Aus ethischer Sicht, aber auch aus Sicht des Tierschutzgesetzes ist aber das bewusste Inkaufnehmen einer tödlichen Genkombination obsolet. So umfasst bspw. das österreichische Qualzuchtverbot auch alle jene züchterischen Maßnahmen, die dazu führen, dass „physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigt werden“ (§5 Abs. 1, österr. Tierschutzgesetz).
Blau ist schön, aber gefährlich
Eine weitere Farbvariante, die mit gesundheitlichen Störungen verbunden sein kann, ist die blaue Farbe. Die genetische Grundlage dieser Farbe ist das Verdünnungs- oder Dilution-Gen. Dieses Gen bewirkt eine Verklumpung und Verkleinerung der Pigmentkörnchen, sodass es dadurch zu einer Aufhellung der Farbe kommt. In Bezug auf gesundheitliche Probleme ist das Dilution-Gen ein ambivalenter Geselle – es kann, muss aber nicht zu Störungen führen.
Bekannt sind Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit blauer Färbung bei bestimmten Rassen wie dem Dobermann oder dem Pinscher. Die Bezeichnung „Blue Dobermann-Syndrome“ steht für eine schwerwiegende Erkrankung der Haut, die im Zusammenhang mit der Verdünnungsfarbe auftritt. Das Hauptsymptom der auch als „Farbmutantenalopezie“ bezeichneten Erkrankung ist ein mehr oder weniger ausgeprägter Haarverlust durch brüchige Haare. Die Haut ist trocken und schuppig, es entwickeln sich eitrige Pickel, in ausgeprägten Fällen kann es zu einer generalisierten Pyodermie, also einer eitrigen Entzündung der gesamten Hautoberfläche kommen. Es ist zu vermuten, dass hinter der Neigung zu eitrigen Entzündungen der Haut eine allgemeine Immunschwäche der Haut steht, die mit der geringeren Dichte der Pigmentkörnchen assoziiert ist.
Das Teuflische an der Erkrankung ist, dass sie nicht alle Hunde mit Verdünnungsfarbe betrifft. So ist z.B. der Weimaraner, dessen Rassemerkmal ja u.a. das verdünnte Braun ist, offensichtlich nicht betroffen. Das Vorliegen des Verdünnungsgenotyps alleine scheint also nicht ausreichend zu sein, um die Veränderungen der Farbmutantenalopezie auszulösen. Welche anderen Faktoren dabei noch beteiligt sind, ist bislang unbekannt. Es ist aber zu vermuten, dass bestimmte bisher noch nicht bekannte Gene in Zusammenarbeit mit dem Verdünnungsgenotyp die Erkrankung auslösen.
Für den Verdünnungsfaktor ist inzwischen ein Gentest verfügbar – für Rassen mit hohem Risiko sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, bei Zuchttieren diesen Gentest durchzuführen, um die Verpaarung von zwei heterozygoten Anlageträgern zu vermeiden. Die gute Nachricht dabei ist, dass Anlageträger nicht notwendigerweise aus der Zucht ausgeschlossen werden müssen. Verpaart man sie mit Tieren, die homozygot für das dominante Nichtverdünnungsgen sind, können bei den Nachkommen keine homozygot verdünnten Tiere auftreten.
Woher kommt das Silber beim Labrador
Ein Problem der Verdünnungsfarben ist u.a., dass sie einen recht attraktiven Phänotyp ergeben. Und das verlockt dazu, die Färbung auch in Rassen zu bringen, in denen das Verdünnungsgen bislang nicht aufgetreten ist. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Auf natürlichem Weg kann das durch eine Spontanmutation geschehen, ein eher unwahrscheinliches aber nicht auszuschließendes Ereignis. Solche Mutationen können eine ganze Weile zurückliegen. Rezessive Gene, die durch eine Mutation entstanden sind, bleiben zunächst mal eine ganze Weile unerkannt in einer Population, da sie im Phänotyp ja nur dann erkennbar werden können, wenn sie im homozygoten Genotyp auftreten. Es müssen also zunächst zwei heterozygote Anlageträger zur Verpaarung kommen. Und bis es soweit ist, kann sich das rezessive Gen schon ein paar Generationen lang unerkannt in der Population verbreitet haben.
Die zweite Möglichkeit ist die einer Einkreuzung. Die kann bewusst und gezielt passieren, aber auch unbeabsichtigt durch eine unbekannte Fehldeckung. Auch in diesem Fall bleibt das neue Verdünnungsgen zunächst mal unerkannt, Es sei denn, die Einkreuzung war bewusst durchgeführt worden und das Einbringen der neuen Verdünnungsfarbe eine geplante Aktion. Denn dann werden sicherlich gezielte Paarungen die in dem Fall gewünschte Farbe schneller ans Tageslicht befördern.
Das Thema ist auch recht aktuell. So tauchen zurzeit bei den Labrador Retrievern vermehrt silberfarbene Hunde auf. Das Silber ist in dem Fall als verdünnte Variante von braunem Eumelanin zu sehen. Da der Ursprung der silbernen Farbe dem Vernehmen nach im Umkreis eines Züchters vermutet wird, der neben Labrador Retrievern auch Weimaraner züchtete, liegt der Verdacht nahe und wird auch intensiv diskutiert, dass die Grundlage dieser silbernen Labrador-Variante eine Einkreuzung von Weimaranern ist. Diese Frage ließe sich mit einer gewissen Sicherheit durch eine molekulargenetische Rassezuordnung, die inzwischen von diversen Laboren angeboten wird, klären. Sofern der Weimaraner als Referenzrasse in der Datenbank des jeweiligen Labors aufscheint, lassen sich Weimaraner-Gene – sofern vorhanden – bei fraglichen Labradoren mit recht großer Wahrscheinlichkeit nachweisen.
Grundsätzlich ist gegen eine Einkreuzung nichts einzuwenden, eine Erweiterung der genetischen Varianz tut im Grunde jeder Rasse gut. Allerdings sind in diesem Fall zwei Aspekte zu bedenken. Ein Aspekt ist die Frage, wieweit hier möglicherweise auch Gene immigriert werden, die unerwünschte Verhaltensmerkmale zur Folge haben. Der Weimaraner ist ein Vollblutjagdhund, dem eine ausgeprägte Jagdleidenschaft nachgesagt wird – nicht unbedingt ein Merkmal, das von der Zielgruppe der Labradorhalter, die in den meisten Fällen einen sozialverträglichen unkomplizierten Familienhund wollen, gewünscht oder akzeptiert wird.
Ein zweiter Aspekt gilt hier aber auch der Farbe. Beim Weimaraner scheint die Verdünnung keine negativen Konsequenzen zu haben – möglicherweise deshalb, weil bei dieser Rasse diejenigen Gene fehlen, die in Interaktion mit dem Verdünnungsgenotyp zu der Farbmutantenalopezie führen. Beim Labrador Retriever könnten diese Gene aber möglicherweise vorhanden sein. Da man sie noch nicht genau kennt, lassen sie sich auch nicht nachweisen – man muss also im Grunde abwarten, ob sich bei silbernen Labradoren die Symptome einer entsprechenden Hauterkrankung zeigen. Und selbst wenn das zunächst noch nicht der Fall ist, ist das kein Beweis dafür, dass solche Gene nicht doch in der Population vorhanden sind. Es könnte also jederzeit zu der verhängnisvollen genetischen Kombination kommen.
Besonders problematisch wird die Sache dann, wenn auf Grund einer großen Nachfrage viele Züchter auf den Zug der silbernen Labradore aufspringen und durch weitere Einkreuzungen von Weimaranern der Vermehrung des Silbergens nachhelfen. Denn immer dann, wenn Einkreuzungen nicht mit Bedacht und genauer Beachtung des genetischen Umfelds des Kreuzungspartners durchgeführt werden, besteht die Gefahr der Immigration von unerwünschten Defektgenen.
Kopplungen – Wenn Farb- und Defekt-Gen gemeinsam vererbt werden
Wir haben nun eine Reihe von Beispielen kenngelernt, bei denen die Farbe eine Art Doppelfunktion hat, weil die Gene, die für die Farbe verantwortlich sind, auch noch andere, gesundheits- oder verhaltensrelevante, Aufgaben im Organismus erfüllen.
Assoziationen zu anderen Merkmalen können sich aber auch dann ergeben, wenn ein Farbgen mit einem Defektgen gekoppelt ist, d.h. also wenn die beiden Gene auf einem Chromosom in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Hier gibt es meines Wissens keine definitiven Erkenntnisse aus dem Bereich der Hundezucht. Es wäre aber z.B. denkbar, dass die Tatsache, dass vor allem rote Cockerspaniels von der sogenannten Cockerwut – einer Verhaltensstörung, die mit unvorhersehbaren Aggressionsanfällen einhergeht – betroffen sind, auf einer Kopplung zwischen dem Gen für rote Farbe und dem Gen, das für die Cockerwut verantwortlich ist, beruht.
Dass bestimmte Verhaltensmerkmale mit Farbvarianten gekoppelt sind, lassen auch Beobachtungen im Rahmen des Zuchtversuches mit Silberfüchsen von Dimitri Belyaev vermuten. Belyaev war ein russischer Genetiker, der Silberfüchse auf vermehrte Zahmheit selektierte. Seine Hypothese war, dass diese Selektion auf Zahmheit auch die Grundlage der Domestikation des Hundes war. Der Zuchtversuch verlief erfolgreich, nach etwa 15 Generationen waren die Silberfüchse aus der Zuchtlinie zahm wie Hunde. Aber nicht nur das, sie entwickelten auch andere typische Domestikationsmerkmale wie Scheckungsfarben, Hängeohren und Ringelruten. Ob in diesen Fällen Kopplungen die Ursache der domestikationsbedingten Farbveränderungen sind oder die genetischen Veränderungen Gene betreffen, die sowohl im Melaninstoffwechsel als auch im Stoffwechsel von Neurotransmittern eine Rolle spielen, bleibt zu diskutieren.
Bunte Hunde – nur in der Haustierzucht
Scheckungen und andere Farbvarianten, die Abweichungen von der Wildfärbung darstellen, finden sich nicht nur beim Hund als typische Domestikationsfolgen. Auch bei Pferden, Rindern, Schweinen etc. sind in der Haustierhaltung die Farben vielfältiger und bunter als beim Wildtier. Die Tarnfunktion entfällt in der Haustierhaltung, dafür spielen bei der Selektion menschliche Vorlieben eine größere Rolle. Und der Mensch mag es nun mal gerne bunt.
Allerdings ist in der Rassehundezucht Buntheit nur erlaubt, wenn es der Rassestandard auch so vorsieht. Denn Rassehundezüchter müssen sich an den Rassestandard halten, und wenn dieser einen einfarbig hellroten Hund vorsieht, dann fällt jeder Hund, der nicht diesem Standard entspricht, der also entweder einfarbig, aber dunkelrot, oder hellrot, aber mit ein paar weißen Abzeichen, den Ausstellungsring betritt, durch das Raster der strengen Formwertrichter und bekommt keine Zuchtzulassung.
Und das ist eine fatale Entwicklung, denn diese Vorgehensweise führt zu einem Verlust an genetischer Varianz. Und diese ist in den kleinen geschlossenen Rassezuchtpopulationen inzwischen ein kostbares Gut geworden. Hunde aus der Zucht auszuschließen wegen einer rein farblichen Abweichung vom Rassestandard ist absolut kontraproduktiv in Hinblick auf die Gesundheit und die Erhaltung der Rasse. Wohlgemerkt – das gilt natürlich nur für Farbvarianten, die keine Gesundheitsrelevanz haben.
Pudel müssen farbrein gezüchtet werden
Bei den Pudelzüchtern ist in diesem Zusammenhang folgende Vorgangsweise zu kritisieren. Es gibt Rassen, die in Bezug auf Farbe eine relativ große Varianz zeigen, bei denen aber die einzelnen Farbvarianten streng voneinander getrennt gezüchtet werden, wie dies u.a. beim Pudel der Fall ist. Bei dieser Rasse sind Paarungen zwischen verschiedenen Farben verboten, bestimmte Farben sind überhaupt unerwünscht und werden allenfalls außerhalb der Verbände gezüchtet. Aus populationsgenetischer Sicht ist das jedoch eine Verschwendung von genetischen Ressourcen auf der Basis einer übertriebenen Formwertpriorisierung.
Fazit
Fellfarben des Hundes sind es in jedem Fall wert, genauer beachtet zu werden. Aber nicht nur in Hinblick auf ihre optische Wirkung. Farben, die gesundheitsrelevante Nebenwirkungen haben, sollten vermieden werden, auch wenn sie äußerlich attraktiv wirken. Bei Farbvarianten ohne Nebenwirkungen sollten individuelle Abweichungen vom Rassestandard im Sinne der Erhaltung der genetischen Vielfalt einer Rasse nicht die einzige Grundlage eines Zuchtausschlusses sein.
HINTERGRUND
Melanin und Verhalten
Melanin gibt es in zwei Varianten: Das dunkle Eumelanin und das rötliche Phäomelanin. Eumelanin kommt ebenfalls in zwei Varianten vor: bei einer vollständigen Melaninsynthese entsteht schwarzes Pigment; wird die Synthese frühzeitig abgebrochen, entsteht braunes Pigment. Das fertige Melanin wird von den Melanozyten an die eigentlichen pigmenttragenden Zellen, die Keratozyten abgegeben. Fehlt einem Individuum das Enzym Tyrosinase, kann kein Melanin gebildet werden, das Individuum ist ein Albino.
Eines der Zwischenprodukte der Melaninsynthese ist DOPA, aus dem neben dem Melanin auch noch die Hormone Adrenalin und Noradrenalin sowie der Neurotransmitter Dopamin gebildet werden. Wenn nun auf Grund des Fehlens des Enzyms Tyrosinase kein Pigment gebildet werden kann, liegt es auf der Hand, dass auch die Produktion von DOPA und damit die der genannten Hormone beeinträchtigt ist.
Kampfhormon und Bärenkräfte
Noradrenalin wirkt als Hormon sowie als Neurotransmitter und begünstigt aggressives Verhalten. Es wird auch als „Kampfhormon“ bezeichnet und wird u.a. in Situationen produziert, in denen es um die Verteidigung einer sozialen Bindung geht. Adrenalin wiederum ist ein Hormon, das in gefährlichen Situationen dem Körper „Bärenkräfte“ verleiht – es ist das klassische Fluchthormon, das alle Kräfte des Körpers für kurze Zeit mobilisieren kann. Eine eingeschränkte Produktion von Noradrenalin und Adrenalin könnte daher für eine geringere Kampfbereitschaft sorgen So wird albinotischen Tieren eine stärker ausgeprägte Zahmheit nachgesagt.
Albinismus
Beim Hund tritt der echte Albinismus, d.h. also das Fehlen von Tyrosinase, bei keiner Rasse als rassetypische Farbgrundlage auf. Vereinzeltes Auftreten als Folge einer Spontanmutation kann vorkommen und sollte in der betroffenen Population selektiv bearbeitet werden.
Auch kann der grundsätzlich gleiche Stoffwechselweg der Melanine und der Katecholamine (DOPA, Noradrenalin und Adrenalin) zu funktionellen Assoziationen zwischen Farbvarianten, die auf einer unterschiedlichen Menge oder Verteilung von Eumelanin und Phäomelanin beruhen, mit Verhaltensmerkmalen, die von den Katecholaminen gesteuert werden, führen. So wird z.B. angenommen, dass ein hoher Anteil von Phäomelanin mit einem Mangel an Katecholaminen, dafür aber einem erhöhten Cortisolspiegel einhergeht. Daraus könnte sich eine stärkere Ängstlichkeit und Unsicherheit sowie eine schlechtere Stressbewältigung bei Hunden mit einem höheren Anteil an Phäomelanin ergeben.
Zusammenhang Farben und Verhalten?
Ein interessanter Kandidat ist in diesem Zusammenhang auch das ß-Defensin. Es gehört zu einer Gruppe von Proteinen, die den Organismus vor Krankheitserregern, vor allem vor Bakterien und Pilzen schützen. Das ß-Defensin ist zudem an der Pigmentierung beteiligt, es interagiert mit dem Genlocus, der für die Verteilung von Eumelanin und Phäomelanin verantwortlich ist. Wie erst kürzlich festgestellt (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2906624/), sorgt das dominante ß-Defensin-Gen beim Hund für eine durchgehende Einlagerung von schwarzem Eumelanin. Hunde, die das dominante ß-Defensin-Gen tragen, sind somit einfarbig schwarz. Diese Doppelfunktion in der Farbverteilung einerseits und der Erregerabwehr andererseits könnte für Assoziationen zwischen Farbvarianten und Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen verantwortlich sein.
Alle diese Überlegungen sind zunächst mal recht spekulativ. Aussagekräftige Studien dazu sind mir für den Hund keine bekannt. Auf der Basis der biochemischen Zusammenhänge wären aber allenfalls bisher schon immer wieder anekdotisch berichtete Zusammenhänge zwischen Farbvarianten und Verhaltens- bzw. Gesundheitsvariationen erklärbar.
HINTERGRUND
Dalmatiner: „Lieber taub als gescheckt“
Die Vorgangsweise von Dalmatinerzüchtern ist ein besonders krasses Beispiel für den unsinnigen Umgang mit sog. Fehlfarben.
Dalmatiner sind bekanntermaßen die am häufigsten von der sensorineuralen Taubheit betroffene Rasse. Um die Problematik zu verstehen, muss man wissen, dass die Dalmatiner-typische Färbung auf der Wirkung von zwei verschiedenen Genen beruht. Das eine ist das Scheckungsgen, dessen Wirkung in der Hemmung der Melanozytenverteilung besteht. An diesem Genlocus ist der rassetypische Dalmatiner homozygot für das rezessive Gen, das ausgeprägte Weißfärbung bedingt. Die rassetypischen Tupfen kommen jedoch durch die Wirkung eines anderen Gens, des dominanten Tüpfelungsgens, zustande. Die Tüpfelung wird aber erst im Laufe der ersten Lebenswochen sichtbar, d.h. der neugeborene Dalmatiner ist im Normalfall schneeweiß. Ist er das nicht, dann trägt er eine Plattenscheckung, die in der Dalmatinerzucht höchst unerwünscht ist. Da diese bereits unmittelbar nach der Geburt erkennbar ist, war das für viele Dalmatinerzüchter ein Grund, solche Welpen sofort zu töten. Aber selbst die Hunde, die diese nachgeburtliche Selektion überlebt haben, hatten und haben keine Chance, in der verbandsmäßigen Dalmatinerzucht eingesetzt zu werden.
Diese Vorgehensweise ist aber insofern paradox, als es gerade die Hunde mit der Plattenscheckung sind, die mit größerer Wahrscheinlichkeit hörend sind. Speziell dann, wenn die Platten im Kopfbereich lokalisiert sind. Die Selektion gegen Plattenscheckung ist somit eine mehr oder weniger automatische Selektion auf Taubheit. Zynisch erscheint in diesem Kontext die authentische Aussage einer Dalmatinerzüchterin, dass sie lieber einen tauben Dalmatiner als einen mit Plattenscheckung hätte.